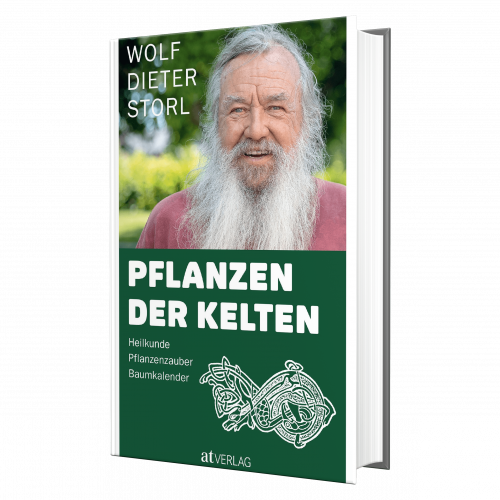Kräuterbäder
- 10. April 2025
Kräuterbäder wurden vor allem durch Sebastian Kneipp (1821–1897) und Kräuterpfarrer Johann Künzle (1857–1945) wieder bekannt gemacht. Beide, äußerst verbunden mit dem einfachen Landvolk, schöpften, ohne es zu wissen, aus altkeltischer Tradition.
Zu den Bädern, mit denen Vater Kneipp beste Erfolge erzielte, gehören folgende:
1. Heublumenbad:
Unter Heublumen versteht man die trockenen Blütenköpfe, Stängel und Blattreste, die sich auf dem Boden des Heuschobers anhäufen und die übrig bleiben, wenn das Heu verfüttert ist. Diese aromatisch riechende Mischung aus den Blüten der Gräser und Sommerwiesenblumen, den Köpfchen von Klee oder Disteln, wird aufgekehrt und bei Bedarf wird ein halbes bis zu einem
Pfund davon aufgekocht und dem (35 ° bis 37 °C) heißen Bad beigegeben. Kneipp verordnete Heubäder bei Rheuma, Gicht, Skrofulose, Nieren-, Blasen- und Unterleibsleiden sowie nervösen Störungen.
Eigentlich eignet sich das Heublumenbad für fast alle Leiden, auch bei viralen Grippen. Bei den Kunstwiesen der heutigen Agrarbetriebe fallen echte »Heublumen« kaum mehr ab. Deswegen sammelt meine Familie für den Jahresbedarf die entsprechenden Blüten und Gräser von Hand und bewahrt sie getrocknet auf. Schon Kräuterpfarrer Künzle nahm die Heublumen nicht von kultivierten Wiesen, sondern ausschließlich von den wilden Bergwiesen seiner Heimat. Als Badezusatz zur Behandlung von Hautkrankheiten kochte er jeweils bis zu 3 Pfund davon auf (Hertwig 1969: 290).
Schon Kräuterpfarrer Künzle nahm die Heublumen nicht von kultivierten Wiesen, sondern ausschließlich von den wilden Bergwiesen seiner Heimat. Als Badezusatz zur Behandlung von Hautkrankheiten kochte er jeweils bis zu 3 Pfund davon auf
(Hertwig 1969: 290).
Wir haben schon gesehen, dass das Heumachen eine keltische Erfindung ist, die es ermöglichte, mehr Vieh den Winter hindurch zu versorgen.
Dem Heu schrieben die Kelten magische Kräfte zu.

Salige Frauen, Hollen und Heinzelmännchen erschienen den Bauern oft bei der Heuernte. Sagen berichten, dass die Wichteln den Bauern bei der Heuernte halfen und mit Sensen aus Haselnussholz das Gras mähten.
Ein Stoß duftendes Heu wurde den Gebärenden – neben anderen »Bettstrohkräutern« und trockenem Binsenstroh – unter das Wochenbett gelegt. Kranke wurden mit qualmenden Heu beräuchert, und zwar von solchem, das in der Erbscheune lag. Und in den Winternächten vergaß man nicht, ein Fuder für den Hirsch des Wintergottes –später für den Schimmel des Nikolaus oder die Rentiere des Weihnachtsmannes – auszulegen.
2. Haferstrohbad:
Kneipp ließ eine Menge von ungefähr 2 Pfund des kieselreichen, gehäckselten Haferstrohs eine Stunde lang kochen und gab es dem Vollbad bei, als Mittel für Grieß- und Steinleiden,
bei Nieren-, Blasen-, Gicht- und Rheumaleiden, ferner bei Fußschweiß und Hautausschlägen.
Hafer, ursprünglich ein Getreideunkraut, das sich in der nordeuropäischen Jungsteinzeit zu einem respektablen Getreide mauserte, ist mit viel Zauber behaftet. In kalten Gegenden gedieh der Hafer
besser als der Weizen. Die Kelten müssen bald gemerkt haben, dass er ihren Pferden gut tat und ihnen viel Kraft gab. Donar, der stärkste Gott der Germanen, war ebenso als begeisterter Haferbreifresser bekannt wie sein irischer Gegenpart, der unersättliche, dickbäuchige, die Blitzkeule tragende Dagda.
In England legten Bauern ein Büschel Hafer während der Weihnachtszeit ins Freie. Besonders wenn dann Tau auf den Hafer fiel, beschützte es im folgenden Jahr die Tiere gegen alle Krankheiten.
3. Walnussblätterbad:
Nach Kneipp werden bis zu 2 Pfund der frischen oder getrockneten Blätter eine dreiviertel Stunde lang gekocht und dann dem Bad zugesetzt. Indikationen sind der skrofulose Symptomkomplex (Rhinitis, Blepharitis, Konjunktivitis, Keratitis, Lymphadenitis), besonders bei Kindern, sowie hartnäckige Wunden und Knocheneiterungen.

Juglans regia folium
4. Kamillenblüten- und Schafgarbenblütenbad:
Bei Wunden, Geschwüren, auch bei Rheuma und Frauenleiden zwei Hände voll mit kochendem Wasser überbrühen, bedeckt ziehen lassen und dann dem Vollbad oder Sitzbad beigeben.
5. Ackerschachtelhalm- oder Zinnkrautbad:
Der am besten im Frühjahr, wenn die Kieselsäure leichter löslich ist, gesammelte Schachtelhalm ist – als Bad und Tee – ein wunderbares Heilmittel bei Bindegewebeschwäche, Geschwüren, schlechter Durchblutung und Stoffwechselleiden. Als Sitzbad hilft er bei Blasen- und Nierenleiden.
Bäder mit Wirkung
Weitere Bäder, die der Altmeister der Naturheilkunde angibt, sind Fichtennadelbäder für rheumatische Beschwerden, Pfefferminzbäder zur Anregung der Lebensgeister, Eichenrindenbäder bei nässenden Ekzemen, Frostbeulen, Hautverbrennungen und Hämorrhoiden, kräftigende, Schmerzen lindernde Weidenrindenbäder … Die Liste könnte beliebig weitergeführt werden.
Fast jede Heilpflanze kann unter Umgehung des Magen-Darm-Traktes über die Haut aufgenommen werden (Kaiser 1996: 275).

Johann Künzle, der Schweizer Kräuterpfarrer, verwendete die Bäderrezepte Kneipps, fügte aber noch die eigenen »Rossbäder« hinzu. Darunter ist ein Rezept für Rheumatiker und Gichtleidende aus einer Mischung aus Wacholder, Tannenharz, Farnwurzel, Brennnesseln und Bergheublumen, wobei zwei bis drei Kilo davon vier Stunden lang zu einem potenten Absud gekocht werden. Nach
dreißig Bädern dieser Art ist der Kranke wieder vollkommen gesund oder ein Engel. Altersschwache Leute kräftigte der Pfarrer mit einer dreistündigen Abkochung aus Tannen- und Fichtenknospen (»Schössli«).
Literaturtipp: Pflanzen der Kelten
Es geht nicht nur um Wirkstoffe, sondern um die Zauberkraft und Magie der Pflanzen. Ich stelle die wichtigsten Heil- und Zauberpflanzen und die Bäume der Kelten in ihrem jahreszeitlichen und kulturellen Kontext, in der Heilkunde und in der Magie vor und beschreibe die Bedeutung des keltischen Jahreskreises und Baumkalenders.
Die Kräuter für den Tee und auch für die Bäder sollten jedes Jahr frisch gesammelt werden. Was nach einem Jahr übrig bleibt, werfe ich nicht auf den Kompost, sondern benutze es, da man in den Bädern größere Mengen braucht, als Bäderzusatz.
Generell sind frische Kräuter am besten. Die optimale Zeit des Sammelns und Pflückens erstreckt sich jedoch nicht über das ganze Jahr, sondern beschränkt sich nur auf eine kurze Zeitspanne. Vorher sind die Wirkstoffe noch nicht voll vorhanden – man kann auch sagen, der Pflanzengeist hat sich noch nicht vollkommen verkörpert –, und danach nehmen schon wieder die jahreszeitlich bedingten Abbauprozesse überhand.
Daher ist es ratsam, die zur optimalen Zeit gesammelten Kräuter sorgfältig zu trocknen (im Schatten) und sie als Droge zu verwenden. (Das Wort hat übrigens nichts mit Rauschgift zu tun, geht auch nicht auf das Wort »Trug« zurück, sondern kommt vom niederdeutschen droog = trocken und bezieht sich auf »trockene« Pflanzenmaterie.) Die Droge befindet sich im suspendierten, »mumifizierten« Zustand; wenn sie von Wasser und Wärme berührt wird, nimmt sie erneut Frische und Farbe an und entlässt die in ihr enthaltenen Heilkräfte.
Bleib auf dem Laufenden!
Wolf-Dieters Newsletter abonnieren
Geschichten, Neuigkeiten und Tipps von Wolf-Dieter Storl und der Storl Akademie